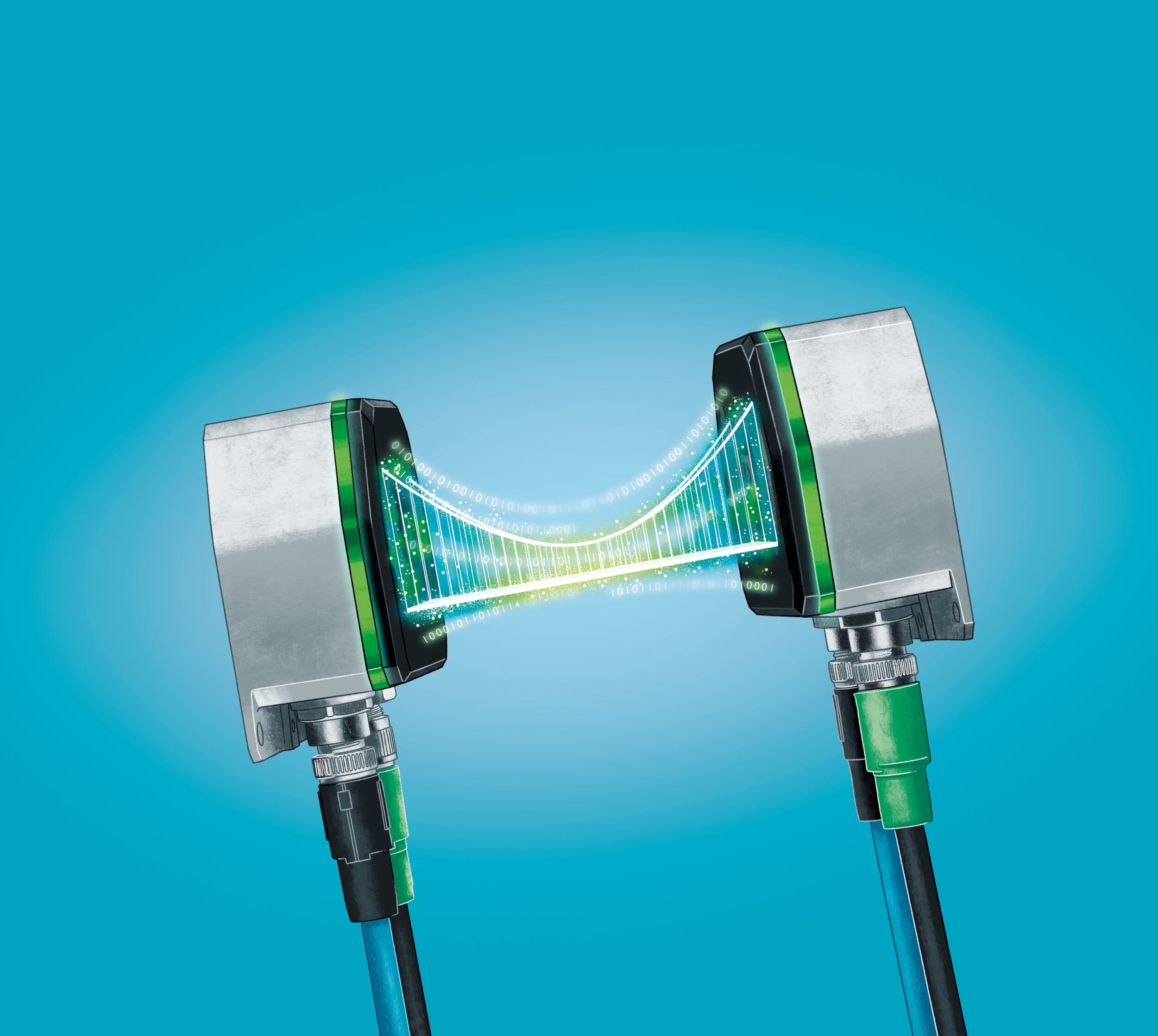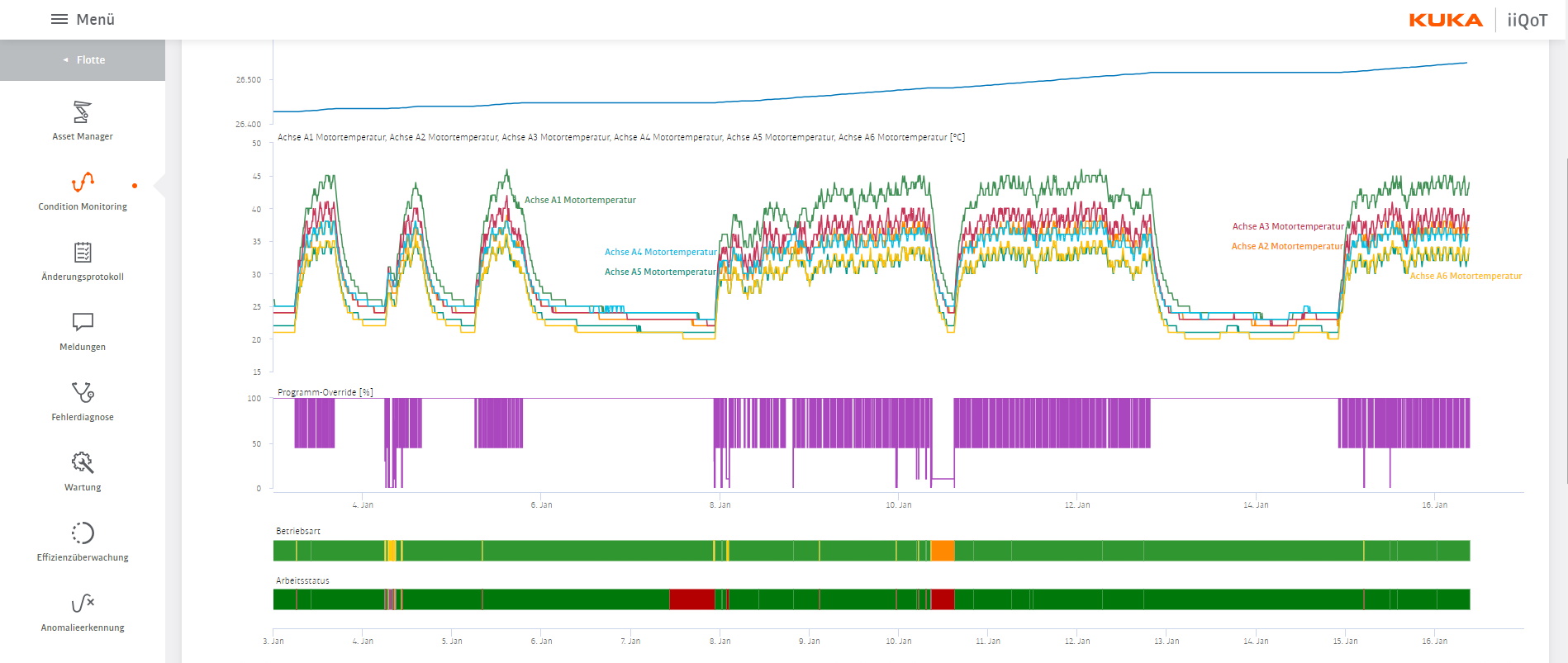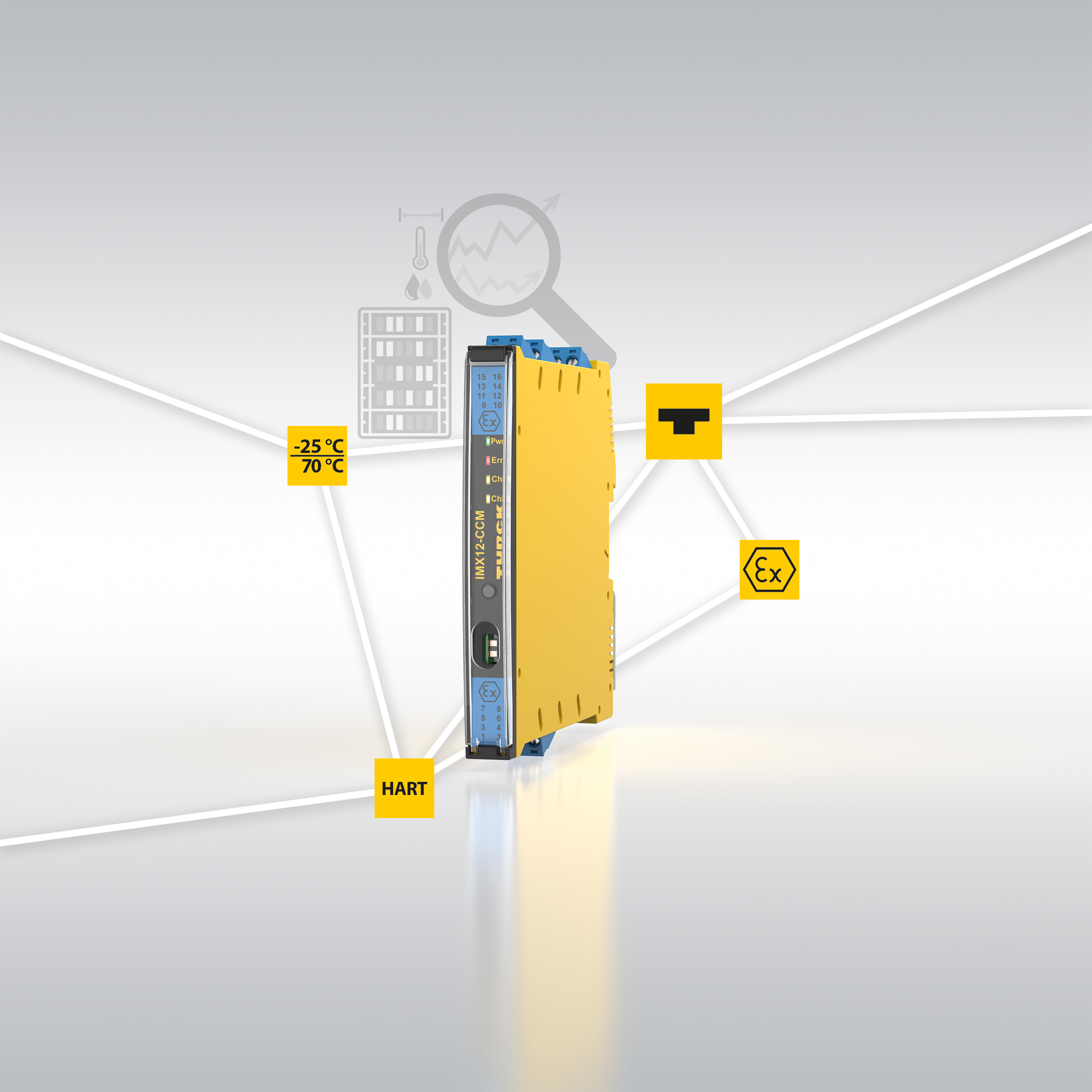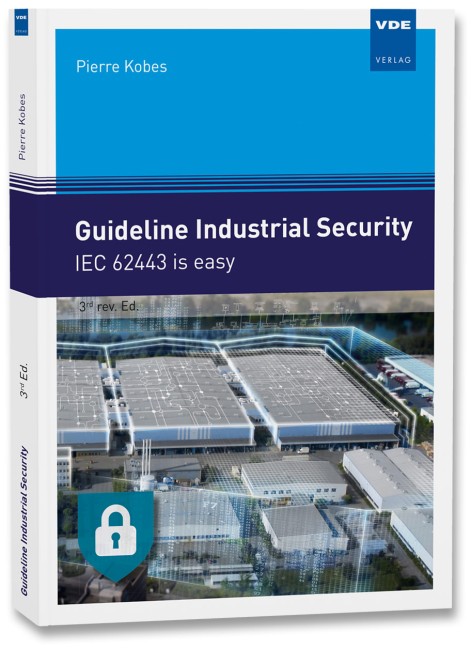Warten auf Techniker im Außendienst oder Warteschleifen in Servicehotlines sind eine unangenehme Begleiterscheinung von Reparaturen und Wartungsprozessen. Sie kosten oft nicht nur Nerven, sondern auch Geld: Bei einem Maschinenstillstand beispielsweise verliert eine Fabrik, die 600 Einheiten pro Stunde mit einem durchschnittlichen Umsatz von 12€ pro Einheit produziert, stündlich 7.200€ an Umsatz – bei Automobilherstellern oft mehr als das Doppelte. Untersuchungen zufolge hat ein durchschnittlicher Hersteller mit bis zu 800 Stunden Ausfall pro Jahr zu kämpfen, was einen Gesamtverlust von mehreren Millionen Euro bedeutet – ganz zu schweigen davon, dass Endprodukte nicht fertiggestellt und dadurch Lieferzeiten nicht eingehalten werden können. Dazu kommt ungenutzte Arbeitszeit. Hersteller müssen deshalb Wege finden, die Ausfallzeiten ihrer Maschinen auf ein Minimum zu reduzieren. Dazu gehören beispielsweise digitale Supportprozesse, bei denen Service-Techniker Fehlersuchen aus der Ferne durchführen können. Ein negativer Effekt einer solchen Fernwartungssoftware ist jedoch, dass der persönliche und individuelle Kontakt in den Hintergrund gerät, wodurch komplexere Probleme oft nicht hinreichend gelöst werden können. Mit Video-Wartung ist der Techniker dagegen auch mit Augen und Ohren virtuell vor Ort.
Visuell mit dabei
Gegenüber anderen digitalisierten Wartungsprozessen bietet ein Video-Tool den Vorteil, dass nicht nur technische, sondern auch visuelle und akustische Komponenten bei der Diagnose berücksichtigt werden können. Dies kann besonders bei Maschinenwartungen oder im Automobilsektor relevant sein, wo Geräusche der Motoren oder Anlagen oft ausschlaggebend für die Problemfindung sind. So können auch komplexere Sachverhalte oder Probleme über einfache ‚Standardprobleme‘ hinaus schneller geklärt werden und remote gelöst werden. Darüber hinaus lassen sich Experten und Spezialisten, beispielsweise für bestimmte Anlagen oder Software, standortungebunden zuschalten und können mit Kunden in Echtzeit agieren. Dies verbessert nicht nur die Servicequalität, sondern macht auch den Weg frei für Support über Ländergrenzen hinweg, ohne dafür hohe Reise- und Fahrtkosten aufzuwenden.
First-time-fix-Rate
Eine hohe Fehlerbehebungsquote schon beim ersten Kundenbesuch ist der Schlüssel jedes erfolgreichen Serviceunternehmens. Dennoch müssen Techniker oft mehrmals anrücken, um beispielsweise fehlende Ersatzteile nachzuliefern. Eine Videodiagnose kann die technische Fehlersuche vorab erleichtern und die First-time-fix-Rate verbessern. Wie etwa beim Druck- und Digitalkonzern Xerox: Ziel des Unternehmens war, die Ausfallzeiten seiner Drucker zu reduzieren und die Servicequalität des Unternehmens zu verbessern – und das möglichst bei gleichbleibender Betriebsmarge. Vor der Umstellung auf Videowartung setzte das Unternehmen auf eine Servicehotline. Ein Außendiensttechniker wurde dann zum Kunden geschickt. Nachdem Xerox seinen Wartungsservice jedoch überwiegend digitalisierte und auf Video umstellte, wurden nicht nur die Servicezeiten reduziert, sondern der gesamte Wartungsprozess vereinfacht: Nun können die Kunden ein Video von ihrem Drucker aufnehmen und das Fehlerbild per Video an einen professionellen Remote-Techniker senden, der die meisten technischen Probleme lösen kann, ohne vor Ort zu sein. Als Ergebnis der Videodiagnose konnte das Unternehmen die First-time-fix-Rate um 67 Prozent verbessern.
Hilfe bei Kleinreperaturen
Auch bei Kleinreparaturen können Video-Lösungen hilfreich sein. DIY(Do it Yourself)-Reparatur-Videos haben auf YouTube oft mehrere hunderttausend Klicks – Verbraucher sind die Nutzung also bestens gewohnt. Hersteller könnten beispielsweise über ein kurzes Live-Video individuell mit dem Kunden kommunizieren und ihn durch eine einfachere Fehlerbehebung führen. Auch herstellereigene Videos, aufbereitet in einer nur für Endanwender zugänglichen Mediathek, könnten einen Mehrwert für Kundenbeziehungen und -loyalität schaffen. Nach den Erfahrungen des Lösungsanbieters Movingimage reagieren Kunden darauf positiv: 68 Prozent bevorzugen demnach Videos, in denen die Lösung für ein Problem erklärt wird. Video-Kundensupport bietet eine unkomplizierte, personalisierte und vielfältige Interaktionsmöglichkeit, von FAQ-Videoclips über How-to-Videos bis hin zum Live-Video-Chat. Der Kunde profitiert von einem benutzerzentrierten Service und das Unternehmen kann den Kunden weiterhin an sich binden und maßgeschneiderten Support liefern.
Protokoll per Video
Schon bei der Bestandsaufnahme von Fehlerquellen kann eine Reparaturwerkstatt ihre internen Prozesse auf ein Minimum reduzieren. Ein Bestandsprotokoll oder Fehlerdokumentation, die Mitarbeiter handschriftlich im Schnitt ca. eine Viertelstunde Arbeitszeit kosten, kann mithilfe einer Videoaufnahme schneller erledigt werden. Das erspart Bürokratie und liefert nachvollziehbarere Dokumentation. Digitalisierte Supportprozesse sparen Unternehmen also viel Zeit, erzeugen aber gleichzeitig eine große Menge an Daten, die sinnvollerweise auf einem nachhaltig nutzbringenden Weg verwaltet werden sollten. Ganzheitliche Lösungen wie Enterprise-Video-Plattformen erleichtern die sichere und DSGVO-konforme Speicherung, Sortierung und Weiterleitung von Videosupportmaterial und verhelfen so zu einer Verbesserung der Workflows. Mithilfe von künstlicher Intelligenz kann so beispielsweise auch die Aufbereitungszeit von Videomaterial verkürzt werden – etwa durch automatische Untertitel oder Keywordsuche.
Es gibt Grenzen
Natürlich kann nicht jede Art von Support remote erfolgen. Insbesondere mit steigender Komplexität von Anlagen und Maschinen wird videounterstützte Fernwartung jedoch an Bedeutung gewinnen. In der Automobilbranche beispielsweise, wie auch im Maschinenbau sowie in anderen Branchen mit komplexen oder erklärungsbedürftigen Produkten wird es zunehmend schwerer werden, Prozesse ohne visuelle Hilfsmittel zu erklären und entsprechenden Support zu leisten. Mögliche Schnittstellen zu anderen Fernwartungstools oder Merged-Reality-Anwendungen können zukünftig dabei helfen, individuelle und branchenspezifische Serviceprozesse durch Integration von Video zu optimieren. Ein größtenteils kontaktloser und effizienter Support wird zukünftig vor allem am Zusammenspiel verschiedener Technologien wachsen.